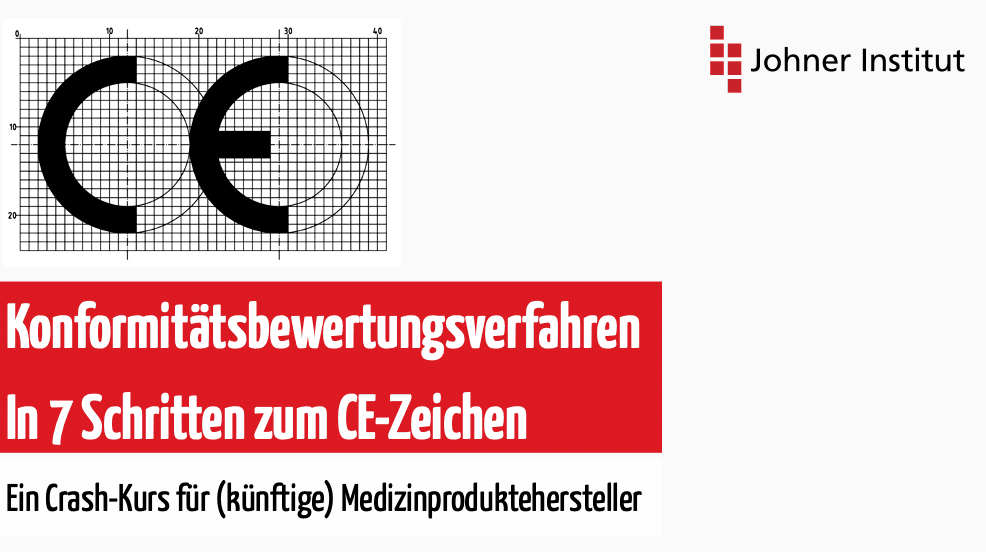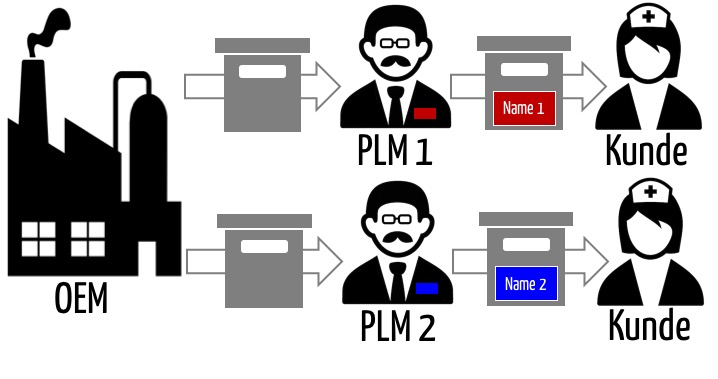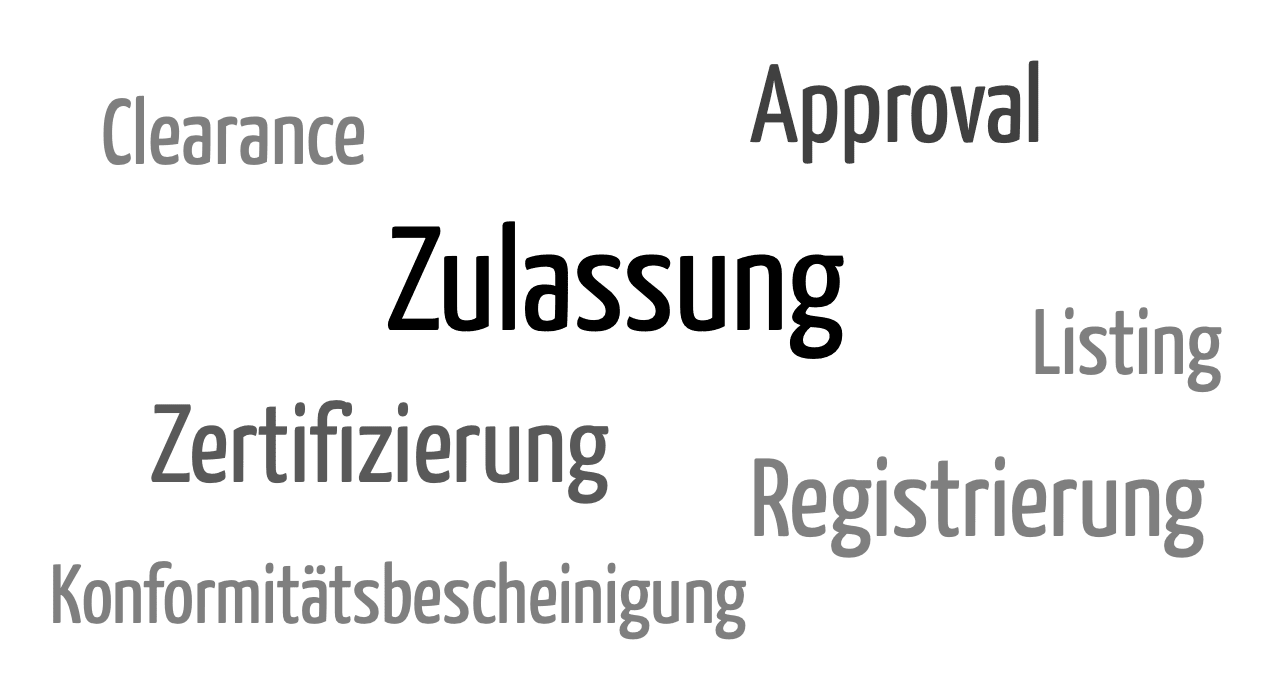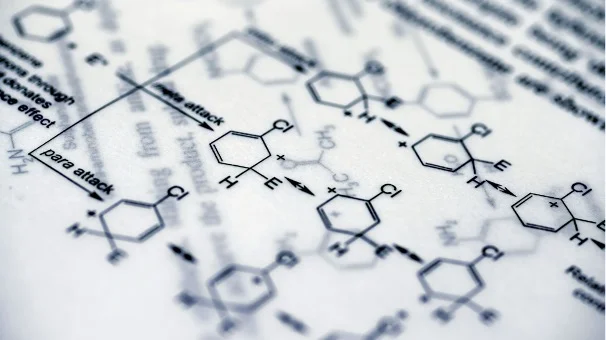Bevor Hersteller ein Medizinprodukt in der EU in den Markt bringen, müssen sie ein Konformitätsbewertungsverfahren (nicht ganz korrekt als Zulassungsverfahren bezeichnet) durchlaufen.
Inhalt
Diese Seite verschafft einen schnellen Überblick und enthält Verweise auf relevante Fachartikel.
- Grundlagen zur Konformitätsbewertung
- Ablauf der Konformitätsbewertungsverfahren
- Weitere Fachartikel zur Konformitätsbewertung
- Unterstützung beim gesamten Verfahren
1. Grundlagen zur Konformitätsbewertung
a) Ziel und Definition
Das Ziel der Konformitätsbewertung besteht darin, dass Medizinproduktehersteller (selbst!) die Konformität ihrer Produkte mit den grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen der EU-Medizinprodukteverordnungen (MDR bzw. IVDR) überprüfen und im Erfolgsfall erklären – mit einer Konformitätserklärung.
Definition:
„Konformitätsbewertung bezeichnet das Verfahren, nach dem festgestellt wird, ob die Anforderungen dieser Verordnung an ein Produkt erfüllt worden sind;“
MDR
Außer bei Produkten der Klasse I müssen die Hersteller bei dieser Konformitätsbewertung eine Benannte Stelle einbeziehen.
b) Konformitätsbewertungsverfahren
Die Hersteller können abhängig von der Klasse des Medizinprodukts ein dazu geeignetes Konformitätsbewertungsverfahren auswählen (s. Abb. 1).
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über diese Konformitätsbewertungsverfahren:
| Beschreibung des Verfahrens |
MDR, IVDR |
| Hersteller errichtet ein vollständiges QM-System und lässt es nach ISO 13485 und dem Anhang (s. rechts) zertifizieren |
Anhang IX |
| Hersteller erstellt die technische Dokumentation und erklärt Konformität |
Anhang IV |
| Hersteller lässt Baumuster von Benannter Stelle prüfen |
Anhang X |
| Hersteller errichtet ein QM-System für Produktion |
Anhang XI part A |
| Hersteller lässt jedes produzierte Produkt von Benannter Stelle prüfen |
Anhang XI part B |
| Hersteller errichtet Qualitätssicherung (Endprüfung) |
Anhang VI |
Im Vergleich zur obsolet gewordenen EU-Richtlinie MDD kennen die EU-Verordnungen MDR und IVDR kein Konformitätsbewertungsverfahren für die Produktion mehr, das ausschließlich auf der Endprüfung der Produkte beruht.
c) Auswahl des Konformitätsbewertungsverfahrens
Abbildung 1 zeigt, welches Konformitätsbewertungsverfahren die Hersteller abhängig von der Klasse des Medizinprodukts wählen dürfen.

Abb. 1: Von der MDR vorgegebene Konformitätsbewertungsverfahren
Das am häufigsten genutzte Konformitätsbewertungsverfahren ist dasjenige nach Anhang IX der MDR, bei der der Hersteller über ein zertifiziertes(!) Qualitätsmanagementsystem verfügen muss.
2. Ablauf der Konformitätsbewertungsverfahren
Das Konformitätsbewertungsverfahren führt zum CE-Zeichen. Dorthin gelangen Hersteller in sieben Schritten:
- Zweckbestimmung des Produkts festlegen
- Anwendbare EU-Verordnung (MDR, IVDR) ermitteln
- Die Klasse des Produkts bestimmen
- Geeignetes Konformitätsbewertungsverfahren auswählen
- QM-System etablieren
- Produkt entwickeln
- Konformität erklären und CE-Kennzeichen anbringen
Die Präsentation auf Slideshare stellt diese Schritte vor.
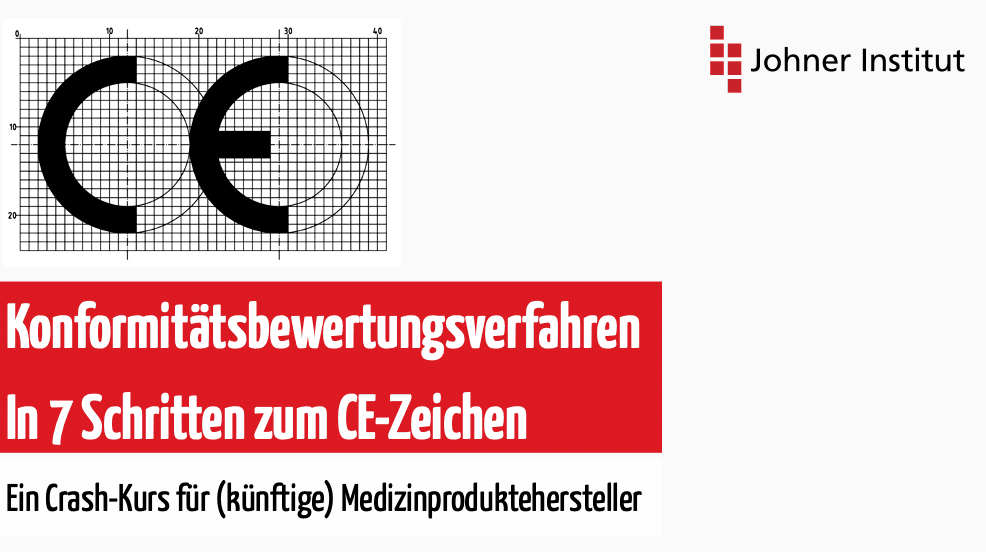
Abb. 2: Präsentation „Konformitätsbewertungsverfahren: In 7 Schritten zum CE-Zeichen“. Zum Öffnen anklicken
Weiterführende Informationen
Eine weitere Präsentation skizziert den zeitlichen Ablauf von der ersten Idee bis zum in den Markt gebrachten Produkt.
3. Weitere Fachartikel zur Konformitätsbewertung
a) Grundlagen
Der Begriff der Konformitätsbewertung wird oft mit den Begriffen Zulassung und Zertifizierung gleichgesetzt, was aber nicht korrekt ist:
b) Nachweis der Konformität
Um den Nachweis zu erbringen, dass ein Produkt den grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen genügt und damit konform ist, sollten Hersteller nutzen:
Wird eine Benannte Stelle in die Konformitätsbewertung einbezogen, benötigen die Hersteller ein Zertifikat. Dazu ist der Artikel „Anfrage versus Antrag auf Zertifizierung“ hilfreich.
c) Spezielle Konformitätsbewertungsverfahren
Weitere Artikel betreffen spezifische Konformitätsbewertungsverfahren:
d) Besonderheiten
Zudem gibt es Artikel, die für einzelne Produktklassen relevant sind:
4. Unterstützung beim gesamten Verfahren
a) Kostenfreies Micro-Consulting
Haben Sie Fragen zur Konformitätsbewertung? Dann nutzen Sie das kostenfreie Micro-Consulting.
b) Beratung
Die Expertinnen und Experten des Johner Instituts sind darauf spezialisiert, Hersteller dabei zu unterstützen, ihre Medizinprodukte schnell und gesetzeskonform in Verkehr zu bringen. Von der ersten Idee, über das QM-Audit bis zum CE-Zeichen:
c) Online-Selbstlernkurse
Für diejenigen, die den Weg lieber weitgehend ohne fremde Hilfe gehen möchten, empfiehlt sich der Auditgarant. Auf dieser Lernplattform lernen Sie anhand maßgeschneiderter Videotrainings, Schritt für Schritt alle oben genannten Aufgaben zu erfüllen. Sie erhalten zudem einen vollständigen Satz an Templates und Mustervorlagen.
Nehmen Sie gleich Kontakt auf, um zu klären, wie Ihr Medizinprodukt am schnellsten ein CE-Zeichen erhält.
Kontakt aufnehmen